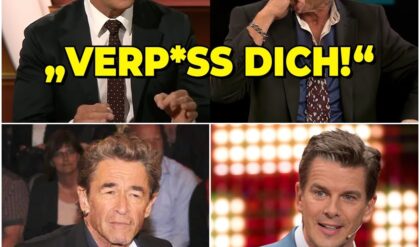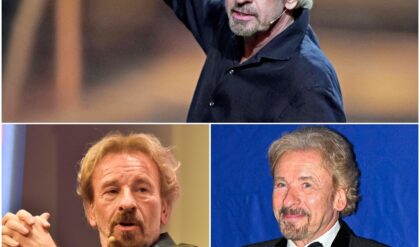Hinter den Kulissen von ABBA: Die herzzerreißende Wahrheit über Björn Ulvaeus und Agnetha Fältskogs zerbrochene Ehe

Die Musik der 70er Jahre wurde maßgeblich von einer schwedischen Band geprägt, deren Melodien bis heute in den Ohren der Menschen nachklingen: ABBA. Doch hinter dem Glitzer und Glamour, den millionenfach verkauften Platten und den euphorischen Bühnenauftritten verbarg sich oft eine weitaus komplexere und schmerzhaftere Realität. Die Ehe von Björn Ulvaeus und Agnetha Fältskog, einst das gefeierte Traumpaar und emotionales Herzstück der Band, wurde zu einem Spiegelbild des hohen Preises, den Ruhm und Erfolg fordern können. Eine Geschichte, die nicht nur von Liebe und Musik, sondern auch von Opfern, Entfremdung und einem tiefen persönlichen Schmerz erzählt.
Der Anfang ihrer Geschichte war wie aus einem romantischen Liedtext entsprungen. Björn Ulvaeus, ein ehrgeiziger Songschreiber, und Agnetha Fältskog, eine junge Sängerin mit einer Stimme, die die Welt verzaubern sollte, trafen sich 1968. Es war eine Begegnung von sofortiger Wirkung, eine Verbindung, die über bloße Anziehungskraft hinausging und auf einer gemeinsamen Vision, ihr Leben durch Musik zu gestalten, basierte. Ihre Liebe blühte in einem Wirbelsturm aus Tourneen, Aufnahmen und nächtlichen Gesprächen über Lieder und Zukunft auf. Für Agnetha war Björn mehr als ein Partner; er war ein Mentor, der sie in die größere Musikwelt führte. Für Björn war Agnetha eine Muse, deren Stimme seine Kompositionen auf eine Weise erhob, die er sich allein nie hätte vorstellen können. Diese Symbiose verwischte die Grenzen zwischen ihrem persönlichen und beruflichen Leben und legte das Fundament für das, was später ABBA werden sollte.
Am 6. Juli 1971 heirateten sie in einer schlichten Zeremonie im Dorf Wum. Es war ein symbolischer Moment, nicht nur für Björn und Agnetha, sondern auch für Benny Andersson und Anni-Frid Lyngstad, die ebenfalls ein Paar bildeten und Schritt für Schritt auf ein musikalisches Schicksal zugingen. Ihre Familie wuchs schnell; 1972 begrüßten sie ihre Tochter Linda, 1977 folgte Sohn Peter. Fotos aus dieser Zeit zeigen ein glückliches Paar mit strahlenden Kindern, doch hinter den Kulissen begannen sich bereits Risse zu bilden.
Der Wendepunkt kam 1974 mit dem Triumph beim Eurovision Song Contest mit „Waterloo“. Über Nacht wurden Björn und Agnetha von schwedischen Stars zu globalen Ikonen. Doch der Jubel hatte einen bitteren Beigeschmack. Als sie nach wochenlangen Wettbewerben und Promotionen nach Hause zurückkehrten, erlebten sie einen Schock, der tiefer ging als jede schlechte Chartplatzierung: Ihre einjährige Tochter Linda erkannte sie nicht wieder. Agnetha nannte diesen Moment später „schrecklich“. Es war eine brutale Erinnerung daran, dass Ruhm Opfer verlangt, die weit über schlaflose Nächte im Studio hinausgehen. Für Agnetha wurde der Balanceakt zwischen Mutterschaft und einer aufstrebenden Karriere zum täglichen Kampf. Sie gestand Jahre später, dass der Druck, ihr Kind zurücklassen zu müssen, nur um zu einem distanziert wirkenden Baby zurückzukehren, Narben hinterließ, die nie ganz heilten. Björn, verzehrt von Songwriting und Abbas Schwung, sah den Erfolg von „Waterloo“ als Bestätigung ihrer Arbeit. Doch für Agnetha war es der Beginn eines Lebens, in dem ihre Familie und ihre Karriere ständig aneinandergerieten.
Bis 1975 war ABBA mehr als nur eine Popgruppe; sie waren eine weltweite Sensation. Hits wie „Mamma Mia“, „Fernando“ und „Dancing Queen“ machten sie zu internationalen Ikonen. Doch mit jedem Erfolg kamen mehr Tourneen, mehr Interviews, mehr Zeit fern von zu Hause. Der Druck auf die Ehe von Björn und Agnetha wuchs mit jedem Jahr. Agnetha, Mitte 20, eine junge Mutter, stand im grellsten Rampenlicht, das die Popwelt je gesehen hatte. 1977, als ihr zweites Kind Peter geboren wurde, sollte sie den Frieden des Familienlebens genießen. Stattdessen balancierte sie zwischen Windeln und Mikrofonen, Flügen und Fotoshootings, Schlafliedern und Proben. Sie gestand, dass es „sehr schwer“ war, gleichzeitig Mutter und globaler Popstar zu sein. Ihr Herz wurde in zwei Richtungen gezogen: Ihre Kinder brauchten sie, aber ebenso die Band, die inzwischen ein weltweites Phänomen geworden war.
Für Björn waren die Anforderungen des Ruhms auf eine andere Weise berauschend. Er blühte im kreativen Antrieb von ABBA auf, verbrachte unzählige Stunden mit Songwriting und Produktion, auf der Jagd nach Perfektion im Studio und beim Formen des charakteristischen Sounds der Gruppe. Er fühlte sich im Wirbelsturm zu Hause, doch Agnetha zunehmend nicht mehr. Ihre Persönlichkeiten, einst komplementär, wirkten nun gegensätzlich: Björn getrieben und von der Arbeit absorbiert, Agnetha sehnte sich nach Stabilität und Nähe.

Die Tourneen vertieften die Kluft nur noch mehr. Agnetha entwickelte eine Flugangst, die das ständige Reisen zur Qual machte. Zudem plagte sie ein ständiges Schuldgefühl, ihre Kinder zurückzulassen. Jede Reise bedeutete wochenlange Abwesenheit, und jede Rückkehr war geprägt von der Erkenntnis verpasster Momente. Für Björn schienen diese Opfer ein notwendiger Preis des Ruhms; für Agnetha waren es Wunden, die sich mit der Zeit vertieften. Die emotionale Belastung begann sich leise zu zeigen. Agnetha beschrieb später, dass sie sich für den Mann, den sie liebte, unsichtbar fühlte, als wäre sie nur noch Teil der Maschinerie von ABBA, aber nicht mehr Teil seiner inneren Welt. „Björn war so auf seine Arbeit konzentriert, dass es kaum noch Platz für uns gab“, erinnerte sie sich. Ihr Leben wurde zu einer Aufführung, lächelnd vor Kameras, Liebeslieder für Millionen singend, während sie privat immer weiter auseinanderdrifteten.
1977, mit zwei kleinen Kindern und ABBA auf dem Höhepunkt, war die Ehe des Paares bereits fragil. Kleine Meinungsverschiedenheiten eskalierten zu wiederkehrenden Streitereien. Björn, pragmatisch und unerbittlich, drängte darauf, für das Wohl der Band stark zu bleiben. Agnetha, sensibler und emotionaler, fühlte sich zurückgewiesen und übersehen. Ihre Unzufriedenheit wurde schwerer, verborgen unter dem Glitzer der Pailletten und dem Applaus ausverkaufter Arenen.
Bis 1978 konnte die Belastung in Björns und Agnethas Ehe nicht länger hinter den Lächeln und den sorgfältig inszenierten Auftritten verborgen werden. Die Band stand noch immer auf dem Höhepunkt ihres Ruhms, doch das Privatleben der Mitglieder zerfiel. Für Björn und Agnetha begannen die stillen Risse, die sich über die Jahre gebildet hatten, endgültig aufzubrechen. Agnetha, erschöpft, kämpfte mit Angst, Einsamkeit und der ständigen Schuld des Mutterseins in Abwesenheit. Sie sehnte sich nach einem ruhigeren Leben, in dem sie ihre Kinder fernab Blitzlichtern und endlosen Tourneen großziehen konnte. Björn hingegen vertiefte sich immer mehr in Songwriting und Produktion, zog sich oft in die Arbeit zurück, anstatt sich dem emotionalen Gewicht ihrer Ehe zu stellen. Ihre Auseinandersetzungen waren selten lautstark, sondern zermürbten sie langsam. Agnetha erinnerte sich, wie sie eines Abends ihr Herz vor Björn ausschüttete und ihn anflehte, ihr Bedürfnis nach Ausgeglichenheit zu verstehen. Seine Antwort – praktisch, kühl, konzentriert auf „stark bleiben im Interesse von ABBA“ – traf sie hart. Sie fühlte sich, als ob ihre Gefühle keine Rolle spielten, als ob die Ehe nur noch eine weitere Aufführung sei, um das Bild der Band aufrechtzuerhalten.
Bis 1979 war die emotionale Distanz zwischen ihnen unüberbrückbar geworden. Sie begannen, getrennte Leben zu führen, auch wenn sie weiterhin Seite an Seite auf der Bühne standen. Im selben Jahr kanalisierte Björn während eines Rückzugs auf der Insel Viggsö seine Gefühle in ein Lied. Mit einer Flasche Whisky an seiner Seite schrieb er die Texte in einem einzigen Durchgang, die den Schmerz einer zerfallenden Liebe einfingen. Zunächst nannte er es „The Story of My Life“, später, mit Agnethas Vorschlag für ein langsameres, chansonartiges Arrangement, nahm es seine endgültige Form an: „The Winner Takes It All“. Die Ironie war grausam: Das Lied, entstanden aus ihrer zerbröckelnden Ehe, wurde zu einem der kraftvollsten und erfolgreichsten Stücke von ABBA. Björn hatte zunächst erwogen, es selbst zu singen, da er es für zu persönlich für Agnetha hielt. Doch am Ende war sie es, die die Worte trug – Worte, die ihr entfremdeter Ehemann über ihre eigene Scheidung geschrieben hatte. Im Studio brach Agnetha in Tränen aus, ihre Mezzosopranstimme bebte, während sie ihren privaten Herzschmerz in eine öffentliche Hymne verwandelte. Kritiker und Fans gleichermaßen feierten es als Abbas Meisterwerk. Für Agnetha jedoch war es Qual. „Ich habe wirklich versucht, mein Leben und meine Gefühle in dieses Lied zu legen“, gab sie später zu.
1980 wurde ihre Scheidung rechtskräftig. Öffentlich präsentierten sie sie als einvernehmlich und erklärten den Medien, man habe „einfach auseinandergelebt“. Doch Agnetha enthüllte Jahre später in ihren Memoiren „As I Am“, dass es „keine glücklichen Scheidungen“ gibt, besonders wenn Kinder betroffen sind. Für sie war der Schmerz tiefer, als sie die Welt erkennen ließ; sie war „emotional zerschlagen“, während Björn nur wenige Wochen später mit einer neuen Partnerin gesehen wurde. „The Winner Takes It All“ verewigte ihre Trennung nicht als private Tragödie, sondern als globales Spektakel. Das Musikvideo, nur zehn Tage nach Unterzeichnung der Scheidungspapiere gedreht, zeigte Agnethas Herzschmerz mit einer Rohheit, die kein Drehbuch hätte inszenieren können. Für Millionen von Fans war es nur ein Lied; für sie war es ein schmerzhafter Spiegel ihres verlorenen Lebens. Das Ende ihrer Ehe markierte auch den Beginn vom Ende ABBAs. Zwar bestand die Band noch einige Jahre weiter, doch die emotionale Belastung, nach solch persönlicher Zerstörung weiterhin Liebeslieder zu singen, war unerträglich.
Nach der Scheidung versuchten Agnetha und Björn, nach außen hin eine geschlossene Front zu zeigen. Doch hinter verschlossenen Türen war das Nachspiel alles andere als einfach. Für Agnetha war die Trennung verheerend; sie gab später zu, dass sie eine Therapie brauchte, um den Verlust zu verarbeiten, besonders da Björn schnell weitermachte und innerhalb weniger Wochen eine neue Beziehung begann. Berichte beschrieben sie damals als emotional zerschlagen. In ihren Memoiren gestand sie, dass die öffentliche Darstellung einer glücklichen Scheidung nur eine Fassade war.
ABBA machte nach der Trennung noch eine kurze Zeit weiter, doch die Chemie, die die Gruppe einst geprägt hatte, war verschwunden. 1982 war klar, dass die Magie vorbei war. Die Band hörte stillschweigend auf aufzunehmen, und die vier Mitglieder gingen getrennte Wege. Für Björn bedeutete das, sich tiefer ins Songwriting mit Benny zu vertiefen und Musicals wie „Chess“ zu erschaffen. Für Agnetha bedeutete es, sich in ein ruhigeres Leben zurückzuziehen, wenn auch nicht ohne Kampf. Ihre ersten Versuche als Solokünstlerin waren vielversprechend, doch hinter der Studioarbeit zerbrach ihr Privatleben weiter. Sie ging mehrere kurzlebige Beziehungen ein, auf der Suche nach Stabilität nach dem Herzschmerz. Ihre zweite Ehe mit dem schwedischen Chirurgen Thomas Sonnenfeld, die sie 1990 in einer privaten Zeremonie einging, endete bereits 1993.
Die 1990er Jahre gehörten zu den schwierigsten Jahren für Agnetha. 1994 erlitt sie den herzzerreißenden Verlust ihrer Mutter, und nur ein Jahr später starb auch ihr Vater. Diese Tragödien erschütterten sie zutiefst. Sie zog sich noch weiter aus der Öffentlichkeit zurück und mied das Rampenlicht. Ihre Kämpfe wurden durch ihre Erfahrungen mit dem Ruhm selbst noch verschärft. Sie hatte lange mit Flugangst zu kämpfen, Menschenmengen überwältigten sie, und obsessive Fans verwischten die Grenze zwischen Bewunderung und Eindringen. In den späten 1990ern führte ihre Verletzlichkeit zu einem der beunruhigendsten Kapitel ihres Lebens: Sie geriet in eine Beziehung mit Gert van der Graaf, einem niederländischen Gabelstaplerfahrer, der sie jahrelang gestalkt hatte. Trotz offensichtlicher Warnsignale gab Agnetha zu, dass sie von seinem intensiven Interesse angezogen war und beschrieb, wie seine Fixierung sie in einer Zeit der Einsamkeit bemerken ließ. Die Beziehung wurde schnell toxisch, Van der Graaf wurde besitzergreifend und instabil. Seine Besessenheit schlug in Missbrauch um, bis Agnetha ihn 2000 bei der Polizei anzeigte, was zu seiner Abschiebung in die Niederlande und einer einstweiligen Verfügung führte. Doch er verstieß mehrfach gegen die Anordnung. Diese Episode traumatisierte Agnetha und verstärkte ihr Misstrauen gegenüber Fremden und ihr Bedürfnis nach Isolation.
In dieser Zeit wirkte Björns Leben deutlich stabiler. 1981 heiratete er Lena Källersjö, eine Fernsehmoderatorin, und sie bekamen zwei gemeinsame Töchter. Ihre Ehe hielt mehr als vier Jahrzehnte, auch wenn sie sich schließlich trennten. Während Björn seine berufliche Partnerschaft mit Benny fortsetzte und in einer zweiten Ehe Trost fand, sah sich Agnetha jahrelanger Einsamkeit, Trauer und persönlichen Kämpfen gegenüber. Ende der 1990er Jahre war sie weitgehend aus dem öffentlichen Leben verschwunden. Sie zog aufs schwedische Land, umgeben von Natur, Hunden und Familie.
Die Wende zum neuen Jahrtausend fand Agnetha Fältskog in einem der fragilsten Zustände ihres Lebens. Doch unter dem Schweigen baute sie sich langsam wieder auf, Stück für Stück. Die frühen 2000er Jahre markierten ihre vorsichtige Rückkehr zur Musik. 2004 veröffentlichte sie „My Colouring Book“, ein Album mit Coverversionen von Liedern aus ihrer Jugend. Es war kein spektakuläres Comeback, doch die Platte hielt sich 25 Wochen in den schwedischen Charts und erinnerte die Welt daran, dass ihre Stimme, wenngleich älter, noch immer jene eindringliche Klarheit besaß, die ABBA unvergesslich gemacht hatte. Für Agnetha war das Projekt weniger ein Streben nach Ruhm, sondern vielmehr eine Wiederverbindung mit der Musik zu ihren eigenen Bedingungen.
2013 schien Agnetha bereit für einen weiteren Schritt nach vorn. Sie veröffentlichte ein neues Studioalbum mit dem schlichten Titel „A“. Produziert von Jörgen Elofsson, enthielt die Platte Originalsongs und ermöglichte es Agnetha, sich als Frau auszudrücken, die Jahrzehnte voller Triumphe und Leiden hinter sich hatte. Ihre Stimme war gereift, reich an Verletzlichkeit und doch unverkennbar die ihre. Für die Fans war das Album mehr als nur Musik; es war ein Signal, dass Agnetha ihre Stärke wiederentdeckt hatte. Sie sang nicht mehr als die junge Frau, die im Strudel von Ruhm und Herzschmerz gefangen war, sondern als jemand, der überlebt hatte, der die schmerzhaften Lektionen von Liebe, Verlust und Einsamkeit gelernt hatte.
In den 2020er Jahren hatte die Geschichte von Björn Ulvaeus und Agnetha Fältskog längst das Gewicht einer Legende angenommen. 2021 geschah das Unvorstellbare: ABBA kehrte zurück. Nach Jahrzehnten der Stille veröffentlichte die Gruppe „Voyage“, ihr erstes Album seit vierzig Jahren. Die Platte war mehr als nur eine Sammlung von Liedern; sie war ein Statement, dass ihre Musik und die Bande zwischen ihnen nie wirklich gestorben waren. Neben dem Album kamen die bahnbrechenden ABBA-Avatare, digitale Avatare, die in einer speziell errichteten Arena in London auftraten. Es war eine Wiedervereinigung wie keine zuvor, eine, die es den Fans ermöglichte, ABBAs Glanz noch einmal zu erleben, ohne von den mittlerweile 70-jährigen Mitgliedern den zermürbenden Zeitplan globaler Tourneen zu verlangen.
Für Björn war „Voyage“ ein weiteres Kapitel in einem Leben voller kreativer Leistungen. Er blieb tief in Projekte, Interviews und die Bewahrung von ABBAs Vermächtnis eingebunden. Seine Ehe mit Lena endete 2022 nach mehr als 40 Jahren, doch die Trennung verlief einvernehmlich. Bald fand er in Christina Sas neue Begleitung und 2024 heirateten sie still in Kopenhagen. Beruflich wie privat erwies sich Björn als widerstandsfähig, indem er seine Energie eher in Neuerfindung als in Rückzug lenkte. Agnetha hingegen ging die Wiedervereinigung mit ihrer gewohnten Vorsicht an. Sie hatte Jahrzehnte damit verbracht, das Rampenlicht zu meiden und ein ruhiges Leben in der Nähe ihrer Tochter und Enkelkinder zu führen. Doch auch sie konnte die Bedeutung von ABBAs Rückkehr nicht leugnen. Ihre Stimme, vom Alter weicher geworden und dennoch voller Emotion, wurde zu einem der Höhepunkte von „Voyage“. Zwar entzog sie sich weiterhin dem ständigen Medienrummel, doch ihre Teilnahme sprach Bände: Nach Jahren der Stille war sie genug im Frieden mit sich selbst, um in die Welt zurückzukehren, die sie einst erschaffen hatten.
Die Wiedervereinigung löschte die Vergangenheit nicht aus. Ihre Tochter Linda, einst das Baby, das nach dem Eurovision-Sieg seine Eltern nicht wiedererkannte, war nun in den 50ern. Ihr Sohn Peter näherte sich ebenfalls den 50ern. Beide hatten den Sturm des Ruhms und der Scheidung ihrer Eltern miterlebt, stille Zeugen der Realität hinter dem perfekten Pop-Image. Für Björn und Agnetha würden diese Erinnerungen nie verschwinden, doch mit der Zeit hatten sie gelernt, mit ihnen zu leben. In ihren späteren Jahren fand Agnetha Frieden mit ihren Entscheidungen. Sie erkannte, dass das Verlassen von Björn kein Scheitern gewesen war, sondern ein Akt des Überlebens. Es ging nicht nur darum, ihn zu verlassen, sagte sie rückblickend, „sondern darum, mein Glück zurückzufordern“. Sie trug keinen Groll mehr, nur Weisheit und eine Botschaft für andere, die sich in ihren Beziehungen gefangen oder unsichtbar fühlen könnten: „Verliert euch niemals im Traum eines anderen.“ Die Geschichte von Björn Ulvaeus und Agnetha Fältskog ist eine Geschichte von Leidenschaft, Opfer und Widerstandskraft. Sie gaben der Welt zeitlose Musik, aber um den Preis ihres gemeinsamen Glücks.