Die unbarmherzige Jagd des 21. Jahrhunderts – Wie strategische Em.pörung unsere Gesellschaft vergift**?
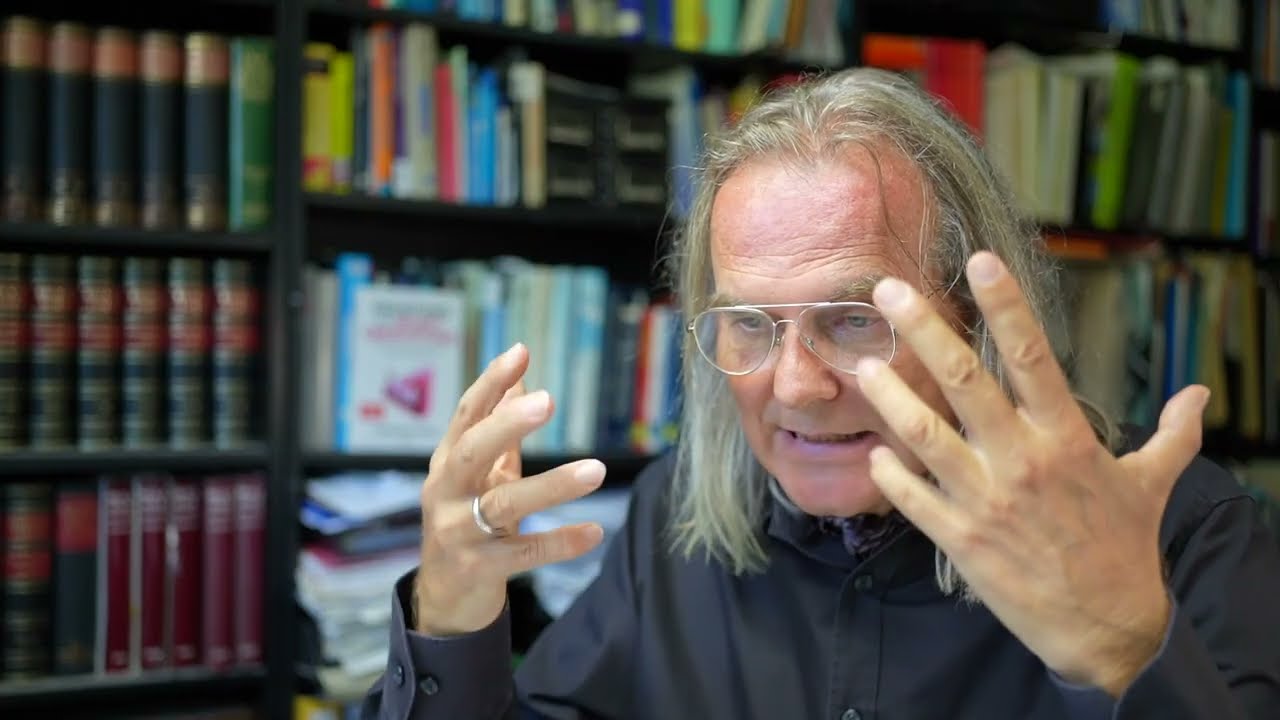
In einer Zeit, in der die öffentliche Meinung oft in den Echokammern der sozialen Medien geformt wird, hat sich ein Phänomen etabliert, das so wirkungsvoll wie gefährlich ist: die sogenannte „Cancel Culture“. Was einst als legitimes Mittel begann, um Personen des öffentlichen Lebens für problematisches Verhalten zur Rechenschaft zu ziehen, hat sich zu einer unbarmherzigen Waffe entwickelt, die Existenzen zerstört, Karrieren beendet und einen Keil in unsere Gesellschaft treibt. Es ist eine moderne Hexenjagd, bei der der digitale Mob den Richter ersetzt und das Urteil oft schon vor der Verhandlung feststeht.
Der renommierte Spieltheoretiker Professor Dr. Christian Rieck hat in einer jüngsten Analyse die Mechanismen dieser Kultur der Annullierung schonungslos offengelegt. Er vergleicht die Methoden der Cancel Culture mit dem Einsatz von Giftgas im Ersten Weltkrieg – eine Waffe, die, einmal entfesselt, unkontrollierbar wird und sich letztlich auch gegen denjenigen richten kann, der sie zuerst eingesetzt hat. „Plötzlich kann der Wind sich drehen“, warnt Rieck, und genau das erleben wir derzeit. Was lange Zeit als eine vornehmlich von der linken Seite des politischen Spektrums genutzte Taktik galt, wird nun auch von der rechten Seite adaptiert. Das Ergebnis ist eine Eskalationsspirale, in der nicht mehr die Sache, sondern die Vernichtung der Person im Vordergrund steht.
Das Muster ist dabei fast immer identisch. Man nehme eine Aussage, eine Geste oder eine Handlung einer Person, reiße sie vollständig aus dem Kontext und bausche sie zu einem Skandal auf. Das Ziel ist es, einen bestimmten Schwellenwert der öffentlichen Empörung zu überschreiten. Ist dieser Punkt erreicht, verselbstständigt sich die Kampagne. Der inhaltliche Diskurs stirbt, und der Angriff verlagert sich von der Sachebene auf die persönliche Ebene. Es geht nicht mehr darum, ob eine Aussage richtig oder falsch war, sondern darum, die betroffene Person gesellschaftlich und wirtschaftlich zu isolieren und zu zerstören.
Ein Paradebeispiel für diese Dynamik ist der Fall der ZDF-Journalistin Dunja Hayali. Nach einer Äußerung über ein Opfer rechter Gewalt sah sie sich einer Welle von Programmbeschwerden und öffentlichen Anfeindungen ausgesetzt. Rieck stellt klar, dass ihre Aussage zwar möglicherweise unsachlich war, aber weit entfernt von Hassrede oder gar einer Billigung von Terror. Dennoch wurde eine Kampagne losgetreten, die letztlich zu einer „bezahlten Auszeit“ für die Journalistin führte. Hier zeigt sich die perfide Logik der Cancel Culture: Es geht nicht um einen fairen Austausch von Argumenten, sondern um die Bestrafung einer unliebsamen Stimme.
Die Methoden, die dabei zur Anwendung kommen, sind vielfältig und oft von einer erschreckenden Bösartigkeit geprägt. Eine der wirksamsten Taktiken ist das „strategische Missverstehen“. Dabei wird bewusst ein Kontext ignoriert, um eine Handlung oder Aussage in einem möglichst negativen Licht darzustellen. Ein rechter Blogger, der während einer Live-Übertragung eine Tonstörung hat, wird plötzlich beschuldigt, eine Naziparole von sich gegeben zu haben – eine Interpretation, die nur durch eine künstliche Intelligenz möglich war, die kontextfrei nach bestimmten Mustern sucht. Ein Politiker, der während einer Rede ausladend gestikuliert, wird bezichtigt, ein verbotenes Zeichen gemacht zu haben. Selbst der Tech-Milliardär Elon Musk geriet ins Visier, weil er eine Produktvorstellung auf den 8. August legte – eine Zahl, die in rechtsextremen Kreisen als Code gilt. Die Absurdität dieser Vorwürfe spielt keine Rolle, solange sie nur laut genug wiederholt werden.

Eine weitere, besonders verheerende Methode ist die „Kontaktschuld“. Hier reicht es bereits aus, mit einer als „böse“ gebrandmarkten Person in Verbindung zu stehen, um selbst ins Fadenkreuz zu geraten. Als der Unternehmer Theo Müller zu seinem Geburtstag einlud, wurde nicht nur er selbst, sondern auch seine Gäste angegriffen. Der Historiker und Publizist Rainer Zitelmann sah sich plötzlich mit dem Vorwurf konfrontiert, sich durch seine bloße Anwesenheit mitschuldig gemacht zu haben. Seine Dissertation über Hitler wurde als Verharmlosung dargestellt, obwohl es sich um eine wissenschaftliche Arbeit handelte. Diese Taktik ist besonders gefährlich, da sie jeden Dialog im Keim erstickt. Aus Angst, mit den „Falschen“ in Verbindung gebracht zu werden, ziehen sich Menschen zurück, meiden den Diskurs und überlassen das Feld den lautesten Schreihälsen.
Die Beispiele aus der jüngsten Vergangenheit sind zahlreich und zeigen, wie tief diese Kultur des Anprangerns bereits in unserem Alltag verwurzelt ist. Die Firma Milram sah sich einem Shitstorm ausgesetzt, weil sie auf einer Käseverpackung kitschige, positiv konnotierte Bilder von Menschen mit dunklerer Hautfarbe abbildete. Was als harmloses Marketing gedacht war, wurde von einer Seite als rassistisch und von der anderen als übertriebene „Wokeness“ interpretiert. Rieck zieht hier einen faszinierenden Vergleich zu den früheren „Mohrenkopf“-Verpackungen, die ebenfalls kitschige, positiv gemeinte Darstellungen von dunkelhäutigen Menschen zeigten und damals aus der entgegengesetzten politischen Richtung kritisiert wurden. In beiden Fällen, so Rieck, liegt das Problem nicht im Bild selbst, sondern in der böswilligen Unterstellung, die der jeweiligen Gegenseite gemacht wird. Es ist der feste Glaube daran, dass der andere nur das denkbar Schlechteste im Schilde führen kann.
Diese Entwicklung ist Gift für jede offene und demokratische Gesellschaft. Sie ersetzt die Auseinandersetzung in der Sache durch persönliche Diffamierung und den Austausch von Argumenten durch moralische Erpressung. Anstatt miteinander zu reden und zu verhandeln, wird der Gegner zum Feind erklärt, der vernichtet werden muss. Professor Rieck appelliert daher eindringlich an uns alle, dieser Entwicklung Einhalt zu gebieten. „Wir müssen einfach aufhören mit dieser unsäglichen Cancel Culture“, fordert er. „Wir brauchen eine Diskussionskultur und keine Kanzelkultur.“
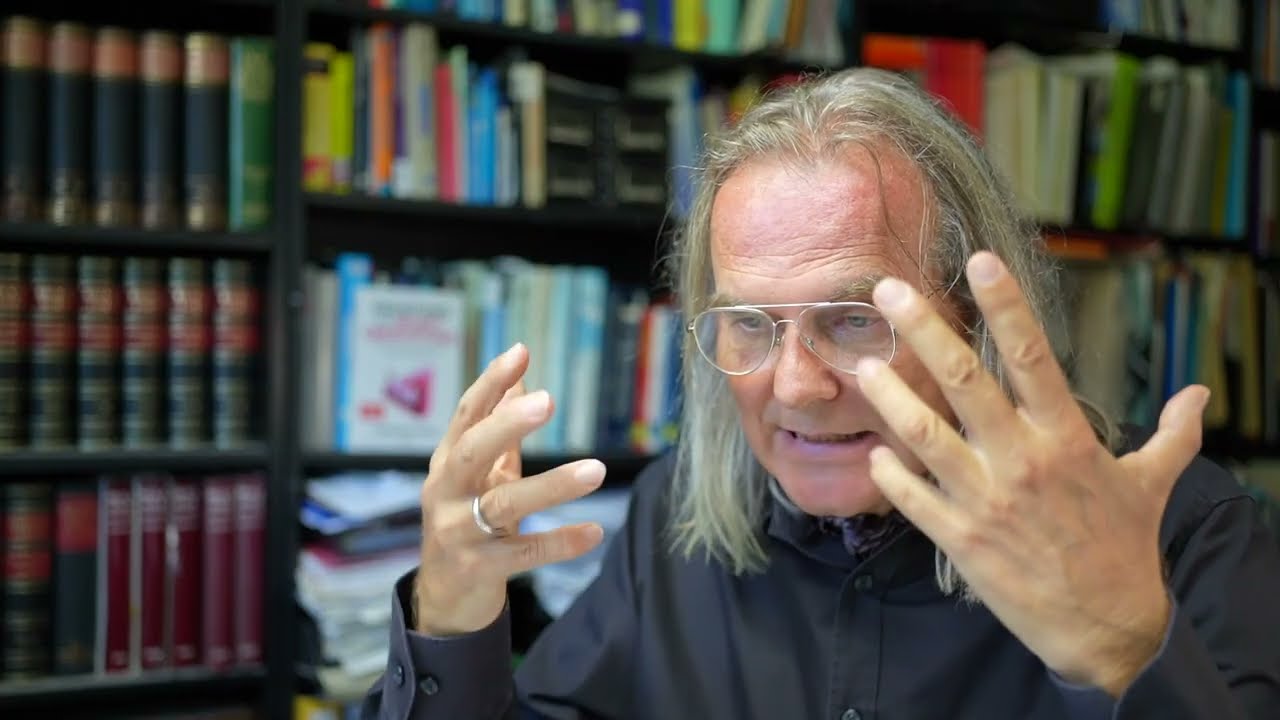
Es ist an der Zeit, dass wir uns wieder auf die Grundprinzipien eines fairen und redlichen Austauschs besinnen. Dazu gehört, dem Gegenüber erst einmal zuzuhören und zu versuchen, seine Position zu verstehen, anstatt ihm von vornherein die bösesten Motive zu unterstellen. Es bedeutet, zwischen der Person und ihrer Meinung zu unterscheiden und Kritik an der Sache nicht mit einem Angriff auf die Existenz zu verwechseln. Nur so können wir den Graben überwinden, der unsere Gesellschaft immer tiefer spaltet. Die Alternative ist ein permanenter Krieg jeder gegen jeden, in dem am Ende nur Verlierer zurückbleiben. Der Weg zurück zu einer gesunden Debattenkultur mag steinig sein, aber er ist alternativlos, wenn wir den sozialen Frieden und die Freiheit der Meinungsäußerung bewahren wollen.





