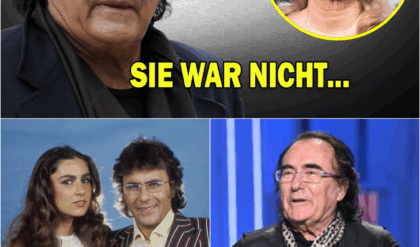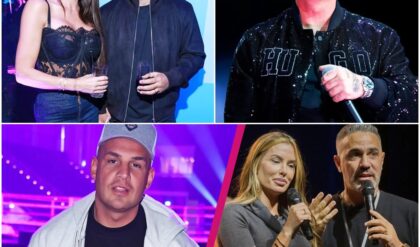Sie ist eine der letzten großen Ikonen des deutschen Kinos, eine Frau, die mit Filmen wie „Die bleierne Zeit“ und „Hannah Arendt“ Geschichte schrieb. Margarethe von Trotta, geboren 1942, gilt als Symbol für intellektuelle Schärfe, unbeugsame Stärke und feministische Pionierarbeit. Ihr Name steht für das Kino der Autoren, für politische Haltung und eine unerschütterliche Würde. Doch hinter dieser Fassade aus Stahl und Intellekt verbirgt sich eine Wahrheit, die erst jetzt, im Angesicht eines schockierenden Geständnisses über ihren „äußerst ernsten Gesundheitszustand“, ihre volle Wucht entfaltet.
Die Nachricht von Trottas gesundheitlichen Problemen trifft die Öffentlichkeit unerwartet. Doch wer ihr Leben und ihr Werk wirklich kennt, erkennt vielleicht die Spuren dieses Zustands, der nicht nur körperlich, sondern vor allem seelisch zu verstehen ist. Es ist die Geschichte einer lebenslangen Auseinandersetzung mit Trauer, Isolation und einem tiefen Gefühl des Missverstandenwerdens, das die Regisseurin nun zu offenbaren scheint.

Geboren in Berlin, inmitten der chaotischen letzten Tage des Zweiten Weltkriegs, war Trottas Kindheit alles andere als friedlich. Sie wuchs in einer Welt auf, die versuchte, die Wunden eines unvorstellbaren Krieges zu heilen, geprägt von Armut, Verlust und der allgegenwärtigen Schuldfrage. Diese Jahre des Wiederaufbaus in einem zerstörten Deutschland prägten sich tief in ihr Gedächtnis ein. Es waren, wie sie selbst sagte, Jahre voller unbeantworteter Fragen: „Warum können Menschen so grausam sein? Warum hinterlässt die Geschichte immer Wunden, die nie heilen?“. Diese existenziellen Fragen sollten sie nie wieder loslassen. Sie wurden zur spirituellen Grundlage ihres gesamten Schaffens, aber auch zum Ursprung einer tiefen, anhaltenden Melancholie.
Als junge Frau wählte sie nicht den einfachen Weg. Statt Sicherheit suchte sie die Kunst – einen dornigen Pfad, aber den einzigen Ort, an dem sie ihre innere Zerrissenheit und ihre drängenden Fragen artikulieren konnte. Sie begann als Schauspielerin, oft besetzt von Volker Schlöndorff, der später ihr Ehemann und kreativer Partner werden sollte. Doch Trotta fühlte sich in den vorgefertigten Rollen gefangen. Sie sehnte sich danach, ihre eigenen Geschichten zu erzählen – Geschichten von Frauen, von Freiheit, von Schmerz und von jener inneren Stärke, die die Welt oft übersah.
Der Schritt hinter die Kamera war eine Revolution in einer damals absolut von Männern dominierten Welt. Eine Regisseurin galt als Kuriosum, fast als Affront. Doch Trotta ließ sich nicht beirren. Sie verstand, dass sie die Kamera selbst halten musste, um die Sichtweise von Frauen in der Kunst fundamental zu verändern. Filme wie „Die verlorene Ehre der Katharina Blum“ (laut Quelle 1977) oder später ihre Meisterwerke „Marianne und Juliane“ (1981) und „Rosa Luxemburg“ (1987) waren nicht nur Filme. Sie waren humanistische Manifeste. Sie erzählten von Frauen, die es wagten, anders zu denken, sich dem System entgegenzustellen und dafür einen hohen Preis zu zahlen.
In diesen Frauen, so scheint es, sprach Trotta immer auch über sich selbst. Sie kämpfte gegen auferlegte Grenzen und suchte unermüdlich nach Wahrheit, selbst wenn dies bedeutete, einsam zu werden.

Und die Einsamkeit kam. Ihre Karriere war der Stolz Deutschlands, doch hinter den Erfolgen und dem Applaus verbargen sich viele Tränen. Die Ehe mit Volker Schlöndorff, eine Verbindung zweier hochintellektueller Künstlerselen, zerbrach. Trotta selbst erklärte diese Trennung mit einer Klarheit, die fast schmerzt: „Wir trennten uns nicht, weil wir uns nicht mehr liebten, sondern weil jeder seinen eigenen Weg ging. Ich brauchte die Freiheit, kreativ zu sein“.
Nach dieser Scheidung widmete sie ihre gesamte Energie der Arbeit. Es wirkte, als habe sie ihren Schmerz in eine unbändige kreative Kraft verwandelt. Ihre Filme wurden tiefer, emotionaler, aber auch, wie Beobachter feststellten, von einer größeren Traurigkeit durchdrungen. Sie schien zu verstehen, was sie später formulierte: Der Preis der Freiheit ist die Einsamkeit.
Dieser „ernste Gesundheitszustand“, von dem nun die Rede ist, scheint eng mit dieser lebenslangen emotionalen Last verbunden zu sein. In der intellektuellen, starken Person steckte, wie sie zugab, eine extrem sensible Seele. Sie sei oft die verletzlichste Person im Raum gewesen, aber diejenige, die es am besten verbarg. Sie kämpfte mit schlaflosen Nächten, mit Erinnerungen und dem Gefühl, das Leben vergehe zu schnell, und so vieles sei unerledigt.
Ihr Sohn bestätigte dieses Bild auf bewegende Weise. Er sagte einmal, seine Mutter sei die stärkste Frau, die er je gekannt habe, aber auch diejenige, die am leichtesten weinte. Margarethe von Trotta lehrte ihn, dass Stärke nicht darin liegt, Tränen zu verbergen, sondern darin, sich dem Schmerz zu stellen und weiterzumachen.
Die größte Traurigkeit ihres Lebens rührte jedoch nicht nur von persönlichen Verlusten her, sondern von dem Gefühl, fundamental missverstanden zu werden. „Eine intellektuelle Frau in der Kunstwelt zu sein, bedeutet, mit der Isolation leben zu lernen“. Jahrelang galt sie als zu philosophisch, ihre Denkweise als zu maskulin, während in Wahrheit alles, was sie tat, von Herzen kam.

Diese Einsamkeit wurde zur bitteren Energiequelle ihrer Kreativität. Ihr größter Wunsch war nie der Ruhm, sondern gehört zu werden. Sie wollte, dass die Welt versteht, dass Frauen Geschichten über Politik, Philosophie und Geschichte erzählen können – Bereiche, die so lange von Männern dominiert wurden.
In späteren Jahren, so enthüllt die Quelle, durchlebte Margarethe von Trotta Phasen einer leichten Depression. Nach Jahren unermüdlicher Arbeit fühlte sie sich leer. Sie beschrieb das Gefühl, dass nach dem Ende eines Films „ein Teil ihrer Seele verschwunden“ sei. Jede Figur, jede Geschichte raubte ihr einen Teil ihrer Emotionen. Wenn alles auf der Leinwand war, fühlte sie sich verloren, als gäbe es nichts mehr, woran sie sich festhalten konnte. Es gab Nächte, in denen sie allein im Dunkeln saß, dem Ticken der Uhr lauschte und das Gefühl hatte, die Zeit würde jede Sekunde ihres Lebens langsam verschlingen.
Doch Trotta wäre nicht Trotta, wenn sie sich hätte unterkriegen lassen. Sie lernte, sich dieser Traurigkeit zu stellen. In einem bemerkenswerten Bekenntnis definierte sie ihren Zustand neu: „Traurigkeit ist kein Feind, sondern ein Begleiter. Sie erinnert uns daran, dass wir dieses Leben noch fühlen, noch lieben“.
Diese Akzeptanz ihres inneren Kampfes ist vielleicht der Schlüssel zu ihrem Überleben. Während sie nach dem Scheitern ihrer ersten Ehe nie wieder heiratete – aus Angst, sich selbst in der Liebe zu verlieren – fand sie Trost in ihrer Familie und in der unerschütterlichen Verbindung zur Kunst.
Ein weiterer, vielleicht der tiefste Schmerz, der sie nie verließ, war der Tod ihrer Mutter. Die Frau, die ihr in den schwierigen Nachkriegsjahren Mut und Opferbereitschaft beigebracht hatte. Als ihre Mutter starb, fühlte es sich an, als wäre ein Teil ihrer Vergangenheit für immer verloren. Dieser Verlust ließ sie lange Zeit verstummen. Sie drehte kaum Filme, schrieb nur Tagebuch. Darin sprach sie von der Angst vor dem Altern, davon, Freunde verschwinden zu sehen, und von dem Gefühl der Leere beim Blick zurück.
Heute, im hohen Alter, bewahrt Margarethe von Trotta ihr würdevolles, ruhiges Auftreten. Sie jagt nicht mehr dem Glamour hinterher, sondern wählt ein einfaches, friedliches Leben. Sie hat den Glauben nie verloren. Sie erkannte, dass man die Sorgen des Lebens nicht auslöschen muss, sondern sie als Teil des Weges akzeptieren kann. Als sie alt wurde, lernte sie, wie sie sagt, zu vergeben – anderen und sich selbst.
Das Geständnis ihres „äußerst ernsten Gesundheitszustands“ ist somit mehr als eine medizinische Diagnose. Es ist das Eingeständnis eines lebenslangen Ringens zwischen Licht und Dunkelheit, zwischen der gefeierten Ikone und der verletzlichen Seele. Margarethe von Trotta hat bewiesen, dass Einsamkeit zum Stoff der Kreativität und Schmerz zur Quelle des Verständnisses werden kann. Sie hat gelebt, geliebt, gelitten und Werke geschaffen, die die Welt zum Nachdenken brachten. Ihr größtes Glück, so scheint es, ist nicht, gelobt zu werden, sondern verstanden zu werden.