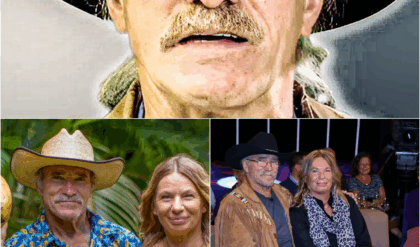Wir sind ers-chüttert über das, was gerade mit Jimmy Kimmel passiert ist.

In der glitzernden Welt des amerikanischen Late-Night-Fernsehens, wo Satire und scharfe politische Kommentare an der Tagesordnung sind, schien Jimmy Kimmel eine unantastbare Institution zu sein. Doch über Nacht wurde seine Show, „Jimmy Kimmel Live!“, auf unbestimmte Zeit aus dem Programm von ABC genommen – ein Schritt, den viele Branchenkenner als das endgültige Aus für den beliebten Moderator deuten. Was auf den ersten Blick wie eine abrupte Sendeplanänderung aussieht, entpuppt sich bei genauerem Hinsehen als ein beunruhigendes Drama über Meinungsfreiheit, unternehmerischen Druck und den wachsenden Einfluss der Regierung auf private Medienunternehmen. Die Wurzeln dieses Bebens liegen in einer gezielten Kampagne, angeführt von niemand Geringerem als Brendan Carr, einem Kommissar der Federal Communications Commission (FCC), der es sich zur Aufgabe gemacht hatte, Kimmel zur Rechenschaft zu ziehen.
Alles begann mit einem Witz, einer jener typischen Pointen, die Kimmel Abend für Abend seinem Publikum präsentierte. Der Moderator äußerte sich zu dem tragischen Mord an dem konservativen Aktivisten Charlie Kirk und merkte an, dass die „MAGA-Bande“ versuche, den Täter als „alles andere als einen von ihnen“ darzustellen. Dieser Satz, gesprochen in den ersten Stunden nach der Tat, als die Informationslage noch unübersichtlich war, sollte zum Bumerang werden. Später stellte sich heraus, dass der Mörder, Tyler Robinson, aus einem persönlichen Motiv handelte, das mit einer komplizierten Beziehung zu einer Transgender-Person zusammenhing – eine tragische, aber keine direkt politisch motivierte Tat im Sinne einer organisierten Bewegung.
Doch in der hyperpolarisierten Medienlandschaft der USA spielte der genaue Kontext bald keine Rolle mehr. Kritiker stürzten sich auf Kimmels Worte und warfen ihm vor, Fakten zu verdrehen und eine ganze politische Bewegung zu verleumden. Was jedoch normalerweise als eine weitere Episode im endlosen Kulturkampf hätte abgetan werden können, nahm eine bedrohliche Wendung, als sich die Bundesregierung einschaltete. Brendan Carr, ein von der damaligen Regierung ernannter FCC-Kommissar, sah seine Chance gekommen. In einem aufsehenerregenden Auftritt in der Show von Benny Johnson legte er detailliert dar, wie man gegen Kimmel vorgehen könne. Er argumentierte, dass Disney, der Mutterkonzern von ABC, „einige Veränderungen sehen“ müsse, und forderte die einzelnen lizenzierten Senderstationen auf, gegen „Müll“-Inhalte wie die von Kimmel vorzugehen.
Diese öffentliche Drohung eines hochrangigen Regulierungsbeamten blieb nicht ohne Wirkung. Der Druck verlagerte sich auf Nextstar, einen der größten Eigentümer lokaler Fernsehsender in den USA, darunter viele ABC-Tochtergesellschaften. Brisant war die Situation vor allem deshalb, weil Nextstar zu diesem Zeitpunkt auf die Genehmigung der FCC für eine massive Fusion im Wert von 6,2 Milliarden US-Dollar mit dem Konkurrenten Tegna wartete. Die Botschaft zwischen den Zeilen war unmissverständlich: Wer nicht kooperiert, riskiert sein Geschäft. Nextstar reagierte prompt auf Carrs öffentliche Äußerungen und übte seinerseits Druck auf Disney aus. Kurz darauf wurde Kimmels Show abgesetzt.

Für Kommentatoren wie Sam Stein und Tim Miller vom politischen Analyseportal „The Bulwark“ ist der Fall kristallklar. Dies sei kein Streit über die Genauigkeit eines Witzes, sondern ein Lehrbuchbeispiel für autoritäres Vorgehen. „Das Kernproblem ist, dass die Bundesregierung private Unternehmen bedroht und unter Druck setzt, um unliebsame Meinungen zum Schweigen zu bringen“, erklärte Miller in einer Analyse. Er bezeichnete es als einen zutiefst beunruhigenden Akt, wenn das Team eines Präsidenten ein Unternehmen dazu drängt, jemanden wegen missliebiger Äußerungen zu entlassen, und diesen Erfolg anschließend auch noch feiert. Es sei ein fundamentaler Angriff auf die im ersten Verfassungszusatz verankerte Meinungsfreiheit.
Die Verteidiger von Carrs Vorgehen argumentieren, Kimmel habe seine Plattform missbraucht, um Unwahrheiten zu verbreiten. Doch diese Argumentation greift zu kurz und ignoriert den größeren Kontext. Zum einen war Kimmels Aussage zum Zeitpunkt ihrer Äußerung nicht völlig aus der Luft gegriffen. In den ersten Stunden nach der Tat gab es tatsächlich Versuche von rechtsextremen Persönlichkeiten wie Dick Fuentes, den Täter ideologisch von sich zu distanzieren, was Kimmels Kommentar in diesem unmittelbaren Moment eine gewisse Berechtigung gab.
Viel wichtiger ist jedoch, dass Kimmel in einer Sendung kurz zuvor die Gewalt scharf verurteilt hatte. In einem ernsten Monolog wandte er sich gegen all jene, die den Tod von Charlie Kirk bejubelten, und rief eindringlich zu Einheit und Mäßigung auf. Diese differenzierte Haltung wurde in der hitzigen Debatte, die auf seinen Witz folgte, vollständig ignoriert. Stattdessen wurde eine einzelne, vielleicht unglückliche Bemerkung instrumentalisiert, um eine Sanktionskampagne zu rechtfertigen, die von höchsten Regierungskreisen orchestriert wurde.
Der Fall Kimmel wirft ein Schlaglicht auf die fragile Beziehung zwischen Medien, Konzernen und der Politik. In einer Zeit, in der große Medienkonglomerate auf das Wohlwollen von Regulierungsbehörden angewiesen sind, entsteht eine gefährliche Angriffsfläche. Der Wunsch, milliardenschwere Fusionen nicht zu gefährden oder Lizenzen zu behalten, kann stärker wiegen als das Bekenntnis zur redaktionellen Unabhängigkeit und zur Verteidigung der Meinungsfreiheit. Die Botschaft, die von diesem Vorfall ausgeht, ist verheerend: Wer sich mit den Mächtigen anlegt, riskiert nicht nur seine Karriere, sondern kann auch zum Spielball in einem größeren politischen Machtkampf werden, in dem das eigene Unternehmen am Ende gezwungen ist, einen zu opfern.
Die Ironie der Geschichte ist, dass viele Konservative, die sich sonst lautstark für die Meinungsfreiheit einsetzen, in diesem Fall schwiegen oder die Maßnahme sogar begrüßten, indem sie sich auf die angebliche „Ungenauigkeit“ von Kimmels Witz konzentrierten. Dies zeigt, so Miller und Stein, dass es hier nie wirklich um Fakten ging. Es ging um Machtpolitik. Es ging darum, einen prominenten Kritiker auszuschalten und ein Exempel zu statuieren.
Das plötzliche Ende von „Jimmy Kimmel Live!“ ist somit mehr als nur das Ende einer Fernsehshow. Es ist ein Alarmsignal für den Zustand der öffentlichen Debatte und ein düsteres Vorzeichen für die Zukunft der Medienlandschaft in einem politisch zutiefst gespaltenen Land. Es zeigt, wie schnell die Prinzipien der freien Meinungsäußerung erodieren können, wenn wirtschaftliche Interessen und politischer Druck aufeinandertreffen. Der Vorhang ist für Jimmy Kimmel gefallen, doch die Fragen, die sein Fall aufwirft, werden die amerikanische Gesellschaft noch lange beschäftigen.